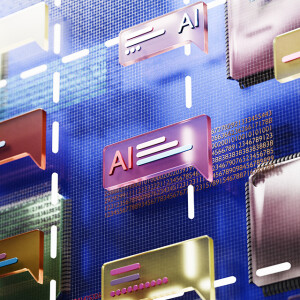Bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) findet eine umfassende Neuausrichtung statt. Geschäftsführerin Dr. Lisa Broß, seit 2024 im Amt, und der langjährige kaufmännische Geschäftsführer, Rolf Usadel, haben den Strategieprozess angestoßen. Neben strukturellen Fragen geht es um Digitalisierungsmaßnahmen, neue Themenfelder und die Zukunft als Fachverband. Katalysierend wirken ein abnehmendes ehrenamtliches Engagement und die baldigen Abgänge der Babyboomer-Generation. Wie man dem Transformationsprozess in der Wasserwirtschaft begegnen will, erklärt Lisa Broß im Interview mit Henning von Vieregge.

Verbändereport: Frau Dr. Broß, Sie sind Sprecherin der Geschäftsführung der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. In knappen Worten: Was macht die DWA konkret?Lisa Broß: Wie der Name schon sagt, Wasser ist unser Thema. Grundsätzlich machen wir alles außer Trinkwasser. Wir sind das führende Netzwerk der Wasserwirtschaft, wir erarbeiten das Regelwerk der Wasserwirtschaft, wir kümmern uns um die Aus- und Weiterbildung, wir generieren Wissen und bringen es in die Fachwelt und wir vertreten die Interessen unserer Branche gegenüber der Politik auf Bundes- und Länderebene – und noch vieles mehr.Es gibt noch einen kaufmännischen Geschäftsführer. Sind Sie gleichberechtigt oder wie ist das geregelt?Ja wir arbeiten gleichberechtigt. Rolf Usadel ist schon seit über 30 Jahren bei der DWA und kennt alle Strukturen. Ich profitiere davon, dass wir als Tandem zusammenarbeiten und uns dank unserer unterschiedlichen Kompetenzen sehr gut ergänzen.Sie haben Anfang 2024 die Geschäftsf