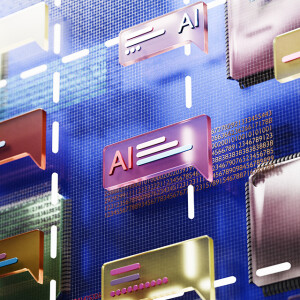Die ganze Welt scheint im Umbruch, da ist es nicht erstaunlich, dass das Thema Veränderung auch in den deutschen Verbänden Hochkonjunktur hat. Es gibt wohl keinen Verband, der heute noch so arbeitet wie vor fünf Jahren. Manche verändern sich sehr bewusst, andere eher notgedrungen. Auffällig ist, dass es zu keinem Stillstand mehr kommt. Eine Art permanente Transformation scheint sich zu verstetigen. Wesentlicher Treiber ist die Zukunftsfähigkeit.

Verbände zwischen Stabilität und WandelEin sich veränderndes politisches Umfeld, der digitale Strukturwandel und die sich wandelnden Mitgliedererwartungen sind nur drei Aspekte, die dafür sorgen, dass sich Organisationen sehr konkret mit der Frage auseinandersetzen, wie es gelingen kann, sich für die Zukunft aufzustellen und auf diesem Weg Veränderungsprozesse aktiv und vor allem erfolgreich zu gestalten.Innovation und Partizipation sind Begriffe, die in diesem Zusammenhang oft fallen. Doch wie innovativ kann man sein, ohne alle Beteiligten zu verschrecken, und wie partizipativ können Veränderungsprozesse aufgesetzt werden, wo doch gerade Verbände und ihre Mitglieder oft in Traditionen verhaftet sind? Funktioniert das Thema Zukunft im Konsens?Ist in Unternehmen bei Zukunftsfragen vor allem das Management gefragt, so ist in Verbänden die Gemengelage an Stakeholdern weitaus größer: Die Mitglieder und das Ehrenamt müssen jeden Schritt auf dem Weg in Richtung Zukunft aktiv mitgehen. Partizipation ist