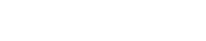Vieles was falsch ist, ist gesetzlich. Vieles, was gesetzlich ist, ist falsch. Denn Überregulierung verwischt die Grenze zwischen Recht und Unrecht, sinnvoll und sinnlos, zwischen produktiv und destruktiv, zwischen Hemmnis und Dynamik.

Überregulierung
Rechtssätze sind keine Seinssätze, sondern Sollenssätze, die einer eigenen Logik folgen. Rechtsätze sagen uns: „Du darfst nicht!“; Naturgesetze dagegen: „Du kannst nicht!“ Die einen sind präskriptiver, die anderen deskriptiver Art. Rechtsgesetze kann man übertreten, Naturgesetze nicht. Wer aus dem Fenster springt, um das Gravitationsgesetz zu übertreten, braucht keinen Schutzmann, sondern einen Schutzengel. Rechtsgesetze brauchen dagegen die Überwachung, um ihren Geltungsanspruch durchzusetzen. Naturgesetze gelten auch, wenn keiner hinguckt; bei Rechtsgesetzen ist das schon problematischer.
Werden in der Gesellschaft Missstände gesichtet, erschallt reflexartig der Ruf nach neuen Vorschriften, nach neuen Schildern im Paragraphen-Dschungel. Auch dies unterscheidet Rechtsgesetze von Naturgesetzen. Keinem Techniker würde es in den Sinn kommen, nach neuen Naturgesetzen zu rufen, nur weil eine Maschine defekt ist.
Je üppiger der Schilderwald von Verboten und Geboten wächst, desto mehr Überwachung und Kontrolle wird notwendig, damit die Rechtsbefolgung gewährleistet ist. In diesem Sinne sind wir längst ein Überwachungsstaat geworden.
Wir sind ein Staat, in dem auf der Basis von rund 60 bis 90.000 Gesetzen und Verordnungen zahllose Ämter und Behörden jede Aktivität der Bürger kritisch beäugen und über Abertausende von Straf- und Bußgeldvorschriften sanktionieren. Wem käme da nicht Bertolt Brecht in den Sinn: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, aber wo geht sie hin?“

Dabei bietet das vorhandene Recht schon jetzt alle Möglichkeiten, gegen bestehende oder vermeintliche Missstände vorzugehen. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des Verordnungsentwurfs für gesundheits- und ernährungsbezogene Werbeaussagen, der so genannten „claims regulation“. Alles, was dort sanktioniert werden soll, ist bereits jetzt nach den bestehenden EG-rechtlichen Regeln verboten. Es besteht daher kein Bedarf an weiteren Regeln auf diesem Gebiet. Hier gilt es, an die dringende Empfehlung des Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu zu erinnern, der dem Gesetzgeber in seinem Werk „De l“esprit des lois“ ins Stammbuch schrieb: „Wenn keine Notwendigkeit besteht, ein Gesetz zu erlassen, dann besteht die Notwendigkeit, das Gesetz nicht zu erlassen!“
Um Missverständnisse zu vermeiden: Es soll nicht einer Rechts-Idylle das Wort geredet werden, der zufolge das Rechtssystem einer modernen Industriegesellschaft so überschaubar und einfach strukturiert sein könnte wie in einer vorindustriellen Agrargesellschaft. Es ist eine Binsenweisheit, dass das Recht gesellschaftliche Komplexität spiegelt. Die Entwicklung des Straßenverkehrs machte die StVO nötig, Kernkraftanlagen brauchen die Entwicklung eines Atomrechts und weltweites Beschaffungsmarketing auf dem Lebensmittelsektor erfordert ein nationales und internationales Lebensmittelrecht. Das reicht von Zusatzstoffen über Höchstmengen und verbotenen Behandlungsmethoden bis hin zum Schutz der konventionellen Landwirtschaft vor ungewollten Kontaminationen mit transgenem Saatgut.
Wofür aber plädiert wird ist, die Freiheitsgewährleistungen unserer Verfassung wieder ernst zu nehmen. Der Grundrechtskatalog des Grundgesetzes sichert nämlich ganz bewusst unantastbare Freiheitsräume, in die auch der Gesetzgeber nicht nach Maßgabe seiner jeweiligen politischen Vorlieben eingreifen darf. Diese Freiheitsgarantien unterliegen gerade in den risikogefährdeten Industriegesellschaften einem schleichenden Erosionsprozess.
Florenz oder Brüssel?
Das moderne Europa ist in den italienischen Stadtstaaten wie Florenz, Venedig, Genua und Ferrara geboren worden. Das nennen wir rinascimento, Rennaissance. Dort haben freie Stadtbürger die Bevormundung durch Feudalismus und Kirche abgeschüttelt, indem sie auf eigene Rechnung und Gefahr Handelswege bis nach China erschlossen und dabei ganz nebenbei die Grundlagen unserer modernen Privatrechtsordnung geschaffen haben. Neben der Vertragsfreiheit zählen hierzu ebenso sehr Erfindungen wie die doppelte Buchhaltung, das Gesellschaftsrecht zur Risikoverteilung an den Kauffahrteischiffen, die Erfindung von Wechsel und Scheck, der Absicherung von Wechselkursrisiken und zahlreiche andere Einrichtungen, die uns heute selbstverständliche Grundlage der Wirtschaftsordnung sind.
Überlegen wir einen Augenblick, ob der kometenhafte Aufstieg der ligurischen, toskanischen und venezianischen Stadtrepubliken überhaupt möglich gewesen wäre, wenn die Entfaltung dieser Kräfte durch rund 60.000 Gesetze „reguliert“ worden wäre. — Nein, dies erfolgte über spontane Ordnungsbildungen, etwas, was wir auch aus der Naturbeobachtung immer dort finden, wo beträchtliches Ungleichgewicht herrscht. Kennzeichen des Aufstiegs war, dass die Entwicklung in Richtung Zukunft offen, also nicht retrospektiv war. Was wir heute Renaissance nennen, war der bewusste Bruch mit überkommenen Regeln. Erst dadurch wurde Platz für Neues geschaffen. Denn Verrechtlichung heißt im Kern, die Vergangenheit zum Maßstab zu wählen (dies folgt notwendigerweise aus der retrospektiven Sichtweise des Normsetzers; denn Rechtsetzung heißt, aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit Regeln für die Zukunft aufstellen); Deregulierung bedeutet demgegenüber und etwas zugespitzt, Entwicklung zu ermöglichen, der Zukunft zu ihrem Recht zu verhelfen. Oder mit den Worten v. Hayeks: „Märkte sind Erkenntnis gewinnende Suchprozesse.“
Nehmen wir zwei weitere Beispiele: Wäre das Internet entstanden, wenn es der deutsche Gesetzgeber mit der geballten Macht von hierzu geschaffenen Fachbehörden unter seine Fittiche genommen hätte? - Hätten wir heute Mobiltelefone zu günstigen Preisen und ohne Wartezeiten, gäbe es noch die gelbe Bundespost?
Minority Driven Societies
Egal, wo man hinschaut: Verbrauchernutzen entsteht dort, wo man Märkten Raum lässt. Missstände sind nie ein Grund zur Strangulierung von Märkten. Das gilt um so mehr als wir eine medien- und „minority driven society“ sind — mindestens, was den Gesetzgeber angeht.
„Florida-Rolf“ wurde erst durch die Bild-Zeitung zum legislativen Katalysator; gleiches lässt sich im gesamten Verbraucherrecht beobachten: Von der Forderung nach Werbeverboten für Alkoholika oder Süßigkeiten, der Forderung, dass jedes Produkt ein Etikett tragen müsse, das darüber belehrt, ob an seiner Entstehung Kinderarbeit beteiligt war, bis hin zur Dämonisierung der grünen Gentechnik: Es sind Minderheiten, die dem Gesetzgeber Beine machen. Und dabei mögen sich Fachleute öfters fragen, ob bei dieser Art von Arbeitsteilung nicht reale Risiken bisweilen unterbelichtet, eingebildete Gefahren dagegen grell überbelichtet werden.
Null-Risiko nur auf dem Friedhof
Im Kern stellt sich in zukunftsorientierten Staaten die Frage: Mit welchem Maß an Unsicherheit und Risiko sind wir bereit zu leben? Oder: Wieviel Freiheit wollen wir für ein Inkrement an zusätzlicher Sicherheit opfern?
Wer jetzt voreilig mit „Null-Risiko“ antwortet, sollte seine Heimstatt eher auf einem Friedhof suchen - wenn überhaupt irgendwo, dann findet man dort ein Null-Risiko. Leben dagegen, Entwicklung und Dynamik sind Prozesse fernab von Gleichgewichtslagen, die notwendigerweise Risiken bergen.
Das Wort „Risiko“ stammt übrigens vom italienischen „risco“, der Klippe, ab und wurde erst später zu „Wagnis“ erweitert. Im 16.Jh. wurden dann unter „Risiko“ die Chancen in der Handelsschifffahrt verstanden.
Ein Gesetzgeber, der mit seiner Gesetzesflut, jedes Risiko ausschließen will, erdrosselt alle Entwicklung, lähmt jede Dynamik und petrifiziert bestehende Strukturen. Ins Soziale übersetzt gilt hier die Gleichung: „Absolute Sicherheit = absolute Unfreiheit = absolute Stagnation“. Schon Goethe meinte zu Eckermann: „Wer den Menschen Freiheit und Gleichheit (lies: Null-Risiko) zugleich verspricht, ist ein Charlatan.“ Oder in den Worten von Jean Paul Sartre: „Bisher hat noch jeder Versuch, auf Erden das Paradies zu errichten, geradewegs in die Hölle geführt!“
Beispiel Lebensmittelpolitik: Von der Qualitäts- zur Verwendungsverantwortung
Die Lebensmittelwirtschaft steht vor einer politischen Neubewertung ihrer Verantwortungsbereiche. Waren die Lebensmittelhersteller in der Vergangenheit dafür verantwortlich, dass ihre Erzeugnisse qualitativ der Verkehrsauffassung entsprachen (Produktverantwortung), so wird ihnen zunehmend auch eine Verantwortung für das Verhalten der Verbraucher im Umgang mit diesen Erzeugnissen - also für deren Ernährung - zugeschoben (Verwendungsverantwortung). Ein erstes Wetterleuchten war die amerikanische prohibition, die Tabakprozesse folgten, jetzt ist die internationale Obesity-Debatte auf der Tagesordnung.
Richtig ist, dass man mit einer Null-Diät nicht an Fettleibigkeit leidet — Lebensmittel sind nun einmal ursächlich für die Entstehung von Fettleibigkeit, so wie eine Lawine ursächlich für den Tod von Skifahrern sein kann. Richtig ist auch, dass zur Zeit eine Reihe von Studien den Zusammenhang von Fettleibigkeit und Ernährung untersuchen. Obwohl die Studien durchweg zu dem Ergebnis gelangen, dass Fettleibigkeit in erster Linie auf fehlende körperliche Aktivität zurückzuführen ist, wird von interessierter Seite versucht, dieses Problem auf die Beschaffenheit bestimmter Lebensmittel zu reduzieren. Dabei zeigt der Vergleich normalgewichtiger mit übergewichtigen Kindern, dass mit Ausnahme der Softdrinks eigentlich keine signifikanten Ernährungsunterschiede bestehen. Schlanke Kinder essen genauso viel Süßigkeiten wie dicke Kinder, sind genauso oft bei McDonalds wie übergewichtige. Was sie unterscheidet sind im Wesentlichen unterschiedliche Muster in der körperlichen Bewegung und die fehlende Sorge des Elternhauses für regelmäßige Mahlzeiten (zum Beispiel für ein gemeinsames Frühstück).
Ein solch verhältnismäßig verwickelter Zusammenhang ist für politische Vereinfacher natürlich nicht brauchbar. Deshalb wird der gedankliche Kurzschluss propagiert „böse Lebensmittel = dicke Kinder“ statt den Ursachenzusammenhang „Gesundheit = Disposition + Ernährung (Verhalten) + Lebensstil (Bewegung)“ zu erkennen.
Allgemein bekannt sind die Produkthaftungsprozesse, die in den vergangenen Jahren in den Vereinigten Staaten gegen die Zigarettenindustrie geführt worden sind. Eine erste Klage war mittlerweile auch in Deutschland anhängig und ist erstinstanzlich abgewiesen worden.
Schlagzeilen machte auch der Prozess eines Richters gegen einen namhaften Markenartikler von Erfrischungsgetränken und Schoko-Riegeln, die er auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagt hatte, weil er in seinen Dienststunden unvernünftig viel Süßwaren und Erfrischungsgetränke verzehrt hatte. Die durch sein Übergewicht auftretende Diabetes führte er auf den Verzehr dieser Erzeugnisse zurück, so dass er beide Unternehmen auf Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen entgangener Lebensfreude verklagte. Die Klage ist ebenfalls erstinstanzlich von den Gerichten zurückgewiesen worden, weil sich der Kläger anhand der Zutatenliste über die Zusammensetzung der Erzeugnisse hätte informieren können. Es fragt sich jedoch, wie ein solches Verfahren ausgegangen wäre, wenn ein Kind Kläger gewesen wäre.
Anfang der 90-er Jahre wurden verschiedene Hersteller von Baby-Tees zu Schadensersatz und Schmerzensgeld verurteilt, weil das ständige Nuckeln der gesüßten Tees zum Zahnverfall bei Kindern geführt hatte. Grund für die Verurteilung waren fehlende Warnhinweise, dass übermäßiger Verzehr den Zähnen schaden kann.
Ein weiterer „Meilenstein“ auf dem Weg von der Produkt- zur Verwendungsverantwortung sind die zunehmenden Werbeverbote. Herstellen bleibt zwar erlaubt, die Vermarktung aber eher nicht. Der Tabakindustrie sind europaweit bereits weitreichende Werbeverbote auferlegt worden; selbst bei so ökologischen und sportiven Ereignissen wie den Formel-I-Rennen. Dabei wird es in Zukunft jedoch nicht bleiben. Im vorparlamentarischen Raum werden bereits Werbeverbote für alkoholische Getränke und für Süßwaren diskutiert. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis auch Feinbackwaren und Torten in das Fadenkreuz der organisierten Verbraucherschützer geraten. Woran sollen sich unsere Kaffeetanten dann noch erfreuen?
Gegen diesen Kreuzzug derjenigen, die nur unser Bestes im Sinn haben, gilt es immer wieder zu betonen: Ernährung und der Gebrauch von Genussmitteln ist ein Verhalten, für das jeder Verbraucher primär selbst verantwortlich ist.
Das schließt die Gefahr des Missbrauchs ein!
Ob die Ernährungsweise angemessen ist, hängt von vielen Faktoren ab, vor allem von einer ausgeglichenen Bilanz von Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch. Diese „Bilanzverantwortung“ den Herstellern von Lebensmitteln zuzuschieben, würde letztlich zu einer weiteren Entmündigung der Verbraucher führen. Denn niemand ist aus Gründen der Staatsraison verpflichtet, sich auf Dauer leistungsfähig und gesund zu erhalten. Nicht zuletzt das unterscheidet die Bundesrepublik vom Dritten Reich, in dem der Volksgenosse eben nicht autonom, sondern nur ein Glied eines übergeordneten Ganzen war.
Von der Privatautonomie zum Betreuungsrecht
Wir erleben im Augenblick den Übergang von der Privatautonomie zu einem allgemeinen Betreuungsrecht, die Reduktion des Verfassungsbürgers zum Verbraucher. Wie sich dies sich in der Transformation von Vorschriften, die ehedem nur einen generellen Handlungsrahmen vorgaben, zu einem allgemeinen Betreuungsrecht spiegelt, sei am Beispiel des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), des Unterlassungsklagen-Gesetzes und des geplanten und auf Länderebene teilweise schon in Kraft gesetzten Verbraucherinformationsgesetzes verdeutlicht.
Juwel Privatautonomie
Zunächst jedoch eine Vorbemerkungen zur Privatautonomie, als der fundamentalen „idée régulative“ unserer Rechtsordnung, also als dem jedem Rechtspositivismus vorgeschalteten „erkenntnisleitenden“ Menschenbild. Keine Rechtsordnung als formalisierte Werteordnung kann auf solche vorrechtlichen, aus Ethos und Moral abgeleiteten Regulativprinzipien Vorverständnis verzichten; sie finden sich bei genauer Analyse selbst in technischen Normen wieder. Denn der Mensch trifft nie voraussetzungslos — gleichsam als tabula rasa — auf die Wirklichkeit: Er begegnet ihr immer schon ausgestattet mit einem Vorverständnis, das sein Tun und Handeln, aber auch seine Wahrnehmung prägt.
Das schlägt sich bis in die Sprache nieder: Die nüchternen Römer nannten die Erfahrungswelt „Realität“, also eine Ansammlung von Gegenständen (res, rerum), die nur darauf wartete vom „homo faber“, dem tätigen Menschen, bearbeitet zu werden. Die Deutschen, nach Heinrich Heine die unvergleichlichen Baumeister von Wolkenkuckucksheimen, erleben Realität dagegen sprachlich als „Wirklichkeit“, als ständiges Ringen allwaltender Kräfte um wahr und falsch. Hegel: „Was wirklich ist, ist gut!“ Ohne dieses Vorverständnis von Wirklichkeit hätte es den gesamten deutschen Idealismus vermutlich nicht gegeben.
Was meint Privatautonomie?
Privatautonomie wird häufig mit dem Begriff der Vertragsfreiheit gleichgesetzt, weil der Vertrag die Hauptform privatautonomer Gestaltung ist. In diesem Sinne umfasst die Privatautonomie vier Grundfreiheiten und zwar die
- Abschlussfreiheit
- Gestaltungsfreiheit oder Inhaltsfreiheit
- Formfreiheit
- Beendigungsfreiheit
- Wechselbezüglichkeit von Anspruch und Verpflichtung (Synallagma)
Unter Privatautonomie versteht man also die Möglichkeit der Selbstgestaltung der Lebens- und Rechtsverhältnisse durch sich selbst. Das Mittel hierzu ist das Rechtsgeschäft, insbesondere der Vertrag. Vertragsfreiheit ist bürgerliche Freiheit schlechthin.
Einschränkungen der Privatautonomie sind also stets Freiheitsbeschränkungen, die zwingend erforderlich sein müssen, um den Schutz anderer Rechtsgüter, die dem Freiheitsrecht des Einzelnen zumindest gleichrangig sind, zu gewährleisten. Hieran sollten wir uns gerade im 200 Todesjahr von Immanuel Kant erinnern, der wesentlich zu theoretischen Begründung der Privatautonomie beigetragen hat. Das Gegenteil privatautonomer Gestaltung ist die Gestaltung von Staats wegen oder im Falle der Geschäftsunfähigkeit durch einen Vormund.
Vor diesem Hintergrund ist es nur aus der autoritären Staatsauffassung vergangener deutscher Staaten her verständlich, dass bis in unsere Tage Gesetzgeber und Administration so große Probleme hatten, den Verbraucher als vernunftbegabtes Wesen wahrzunehmen und ihn statt dessen als stets „flüchtigen“, ahnungslosen Verbraucher fingierten, der intensivsten Schutz durch Beamte und sonstige Kontrollpersonen bedurfte, bis sie durch den Europäischen Gerichtshof eines Besseren belehrt wurden. Im eigenen Gärtchen ist diese Einsicht freilich nicht gewachsen!
Betreuungsrecht am Beispiel des UWG
Zurück zum UWG: Als das UWG im Jahre 1909 in Kraft trat, bezweckte es den lauteren und täuschungsfreien Wettbewerb zwischen konkurrierenden Kaufleuten. Es blieb daher diesen Wettbewerbern überlassen, ob sie gegen vermeintliche Wettbewerbsverstöße von Konkurrenten vorgehen wollten. Nach der jetzt vorliegenden UWG-Novelle werden erstmals Verbraucher ausdrücklich in den Schutzbereich mit aufgenommen. So weit, so gut. Nicht so gut ist es dagegen, dass die Ressortzuständigkeit für das UWG bei der letzten Regierungsbildung vom Wirtschafts- zum Verbraucherschutzministerium wanderte.
Bezeichnend ist, dass diese Novelle den Verbrauchern als anerkannten Marktteilnehmern keine Klagebefugnis eingeräumt, sondern die Geltendmachung von Ansprüchen ausdrücklich den Verbraucherschutzverbänden vorbehält. Natürlich ist das ein Systembruch mit der regulativen Idee der Privatautonomie, die die eigenständige Geltendmachung persönlicher Ansprüche fordern würde. „That’s elementary, Watson!“ würde Sherlock Holmes trocken bemerken.
Für die Geltendmachung der Ansprüche nach dem UWG muss sich der Verbraucher vielmehr an seinen betreuenden Sozialarbeiter namens „Verbraucherschutzverband“ wenden. Offenbar wird er nicht für mündig genug gehalten, seine Rechte selbst wahrzunehmen. Wer auf diese Weise glaubt, den Verbraucher vor sich selbst schützen zu müssen, der schwingt sich zum Vormund auf, dem wird der Bürger zum legislativen Pflegefall. Solches kann man auch als „Verkindergartung“ oder Kollektivierung individueller Ansprüche bezeichnen.
Kollektivierung ohne Repäsentativität
Den Begriff des Kollektivrechts kannten wir bisher nur im Arbeitsrecht, wo die Kollektivvertragsparteien über die Köpfe der Vertretenen hinweg, Tarifverträge zugunsten und zu Lasten Dritter abschlossen. Allerdings fanden und finden solche Normen schaffenden Verträge (daher Tarifautonomie) nur die gesetzliche Anerkennung, wenn die Kollektivpartner über ein Mindestmaß an Repräsentativität und innerverbandlicher Demokratie verfügen.
So können Tarifverträge nur für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn die Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der in den Anwendungsbereich fallenden Arbeitnehmer repräsentieren. Stenogrammatisch: „Legitimation durch Repräsentation“. (Wem fiele hier wiederum nicht die Losung der Boston Tea Party ein: „Taxation by representation!“ - immerhin war das die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten.)
Wenn den Gewerkschaften oder den Arbeitgeberverbänden also die Mitglieder davonlaufen, endet die Tarifautonomie sang- und klanglos. Nicht dagegen im so genannten Verbraucherschutzrecht, das man wie weiland die DDR eigentlich immer in Gänsefüßchen schreiben sollte. Denn dort werden den Verbraucherverbänden Anspruchs- und Klagerechte eingeräumt - unabhängig davon wie repräsentativ sie sind. 75 natürliche Mitglieder sind nach dem Unterlassungsklagen-Gesetz ausreichend, um ungefragt die 80 Millionen Verbraucher vertreten dürfen. Selbst eine Abstimmung mit den Füßen wie bei den Gewerkschaften schränkt hier die Klagebefugnisse nicht ein.
Sehen wir uns das am Beispiel von FOODWATCH einmal genauer an, einer Verbraucherorganisation, die von dem ehemaligen Greenpeace-Direktor Thilo Bode gegründet wurde und sich rühmt, mehr als 6.000 Mitglieder zu besitzen. Chapeau! Das sind aber alles nur fördernde Mitglieder, die keinerlei Stimmrecht haben - Spendenzahler. Stimmberechtigt sind nur maximal 100 Mitglieder. Um in diesen elitären Kreis aufgenommen zu werden, braucht man zwei Bürgen. Über die Aufnahme entscheidet dann ein Aufsichtsrat (über wen?), der aus maximal 7 Mitgliedern besteht.
Soviel zur Repräsentativität bei gleichzeitiger Ent-Individualisierung und Kollektivierung der Ansprüche.
Wachstumsmarkt „Verbraucherschutz-Industrie“
An dieser fürsorglichen Betreuung der Verbraucher arbeitet mittlerweile eine umfangreiche Verbraucher-Schutzindustrie:
- die öffentlich alimentierten Verbraucherschutzverbände, die auf diese Weise ihre Existenzberechtigung nachweisen;
- öffentliche Stellen, die mit immer neuen und erweiterten Aufgaben Einfluss und Stellenpläne ausweiten können;
- Politiker aller Couleurs, die auf diese Weise ihren Wählern klarmachen können, wie sie pausenlos ihre Interessen vertreten;
- Medien, die mit ihrer „Skandalberichterstattung“ um Reichweiten und Quoten buhlen.
Wie die Betreuungsindustrie funktioniert
Das Verbraucherschutzgewerbe funktioniert wie folgt: Das Unterlassungsklagengesetz gibt den Verbänden (nicht den betroffenen Verbrauchern!) das Recht, gegen jeden Verstoß gegen verbraucherschützende Vorschriften zu klagen und ein obsiegendes Urteil auf Kosten des Unterlegenen (beispielsweise eines Handwerkers) im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.
Das geplante Bundes-Verbraucherinformationsgesetz verschafft den Verbänden dann alle notwendigen Informationen, um die Klagemaschinerie in Gang zu setzen. Dieses Gesetz, das bereits in einigen Bundesländern in Kraft getreten ist, sieht vor, dass jedermann einen Rechtsanspruch darauf hat zu erfahren, was bei den zuständigen Behörden Nachteiliges über eine bestimmte Firma bekannt ist. Das bisherige Amtswissen wird also vergemeinschaftet. Die Behörden können diesen Informationsansprüchen nachkommen, indem sie ihr Wissen ins Internet stellen. Das erlaubt kommode „fishing expeditions“, wie man das im amerikanischen Produkthaftungsrecht nennt.
Und um das Ganze noch zu toppen, sieht die UWG-Novelle einen Gewinnabschöpfungsanspruch der Verbände bei so genannten Streuschäden vor. Das sind Schäden, die im Einzelfall so gering sind, dass kein vernünftiger Verbraucher hierfür vor Gericht ziehen würde. Diese werden dann bundes- oder europaweit für die gesamte Zeit des Inverkehrbringens hochgerechnet, von den Verbänden eingeklagt und zu ihrem Kummer — allerdings nach Abzug ihrer Aufwendungen — an die Staatskasse abgeführt.
Für die Verbände trotz allem eine lukrative Angelegenheit, auf irgendeinen Fehler der Wirtschaft zu warten und dann zuzuschlagen. Im Fußball nennt man das „Abstaubermentalität“. Im Kern handelt es sich um die Schaffung pflichtenloser Ansprüche. Nicht das Produktive wird belohnt, sondern das Rechthaberische prämiert. Pieter Breughel hat die Folgen in seinem Schlaraffenland-Bild dargestellt.

So oder so ähnlich funktioniert Wirtschaft — wie manche meinen.
Asymmetrie der Maßstäbe
Dabei erstaunt doch schon die Unterschiedlichkeit der angelegten Maßstäbe: Der Gesetzgeber erlässt pausenlos „Gesetze zu Lasten Dritter“ (als aktuelles Beispiel nur die Ausbildungsplatzabgabe, um nicht tausend weitere Beispiele aufzuführen). Solche „Verpflichtungen zu Lasten Dritter“ wären im privatautonomen Vertragsrecht kategorisch verboten. Doch sind diese von hoher Hand verfügten Lasten von der Wirtschaft zu tragen — ohne Rücksicht darauf, ob es die wirtschaftliche Situation im Augenblick erlaubt. Geht es dagegen an die eigene Leistungsfähigkeit des Staates, dann bestehen so gut wie keine Bedenken, Ansprüche der Bürger auch einmal mit Brachialgewalt zu beschneiden.
Wie würden die Verantwortlichen für die Gesundheits- und Sozialpolitik sich vernehmen lassen, wenn ein in schwerem Wetter befindliches Unternehmen gleiche Maßstäbe reklamieren würde, indem es beispielsweise kundtäte, dass im Blick auf leere Unternehmenskassen der Verbraucher ab sofort für den Preis von 500 g Kaffee nur 450 g erhielte? Oder etwa der Appell: „Kinners, die Löhne, die wir in fetten Jahren vereinbart haben, sind jetzt nicht mehr bezahlbar!“
Es soll damit nota bene nicht der unabweisbare staatliche Sparbedarf kritisiert, sondern nur die Asymmetrie der Maßstäbe beleuchtet werden: Quod licet Jovi, non licet bovi.
Das Massenanziehungsgesetz der Gesetzgebung
So wie die Gezeiten dem Gravitationsgesetz unterliegen, wird auch die Gesetzesflut durch eine Art Massenanziehungsgesetz beherrscht.
Nur dass hier bislang ein Newton fehlt: Die Menge neuer Gesetze ist direkt proportional der Menge schon vorhandener Gesetze. Wie sie sehen, besitzt dieses Massengesetz exponentielles Wachstum. Für eher Bibelfeste sei stattdessen Matthäus zitiert: „Denn siehe, wer da hat, dem wird gegeben werden…“
Dazu nur ein kurzer Blick auf Vergangenheit und Gegenwart: Im Jahre 1871 bestand das deutsche Lebensmittelrecht im Wesentlichen aus einem Paragraphen mit etwa acht Textzeilen. Die gegenwärtige Becksche Dünndruck-Textausgabe „Lebensmittelrecht“ wiegt knapp 4 kg, das entspricht gut und gerne 6 bis 8.000 Seiten, deren Inhalt sich wie ein Perpetuum mobile ununterbrochen ändert.
Nur zur Illustration sei einmal aus der Website des Thüringer Landeskriminalamtes zum Umweltschutz zitiert: „Die Zahl der Gesetze, Verwaltungs- und DIN-Vorschriften und Technischen Regeln (im thüringischen Umweltstrafrecht) beläuft sich gegenwärtig auf annähernd tausend und ist selbst von Unternehmen, Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden schwer zu überschauen und handhabbar.“ Das nennt man im Englischen „sense of understatement“.
Gesetzesflut ist mittelstandsfeindlich
Wer soll diesen Rechtsstoff eigentlich noch kennen, geschweige denn beherrschen? - Ein Mittelständler jedenfalls nicht.
Von diesem wird nämlich erwartet, dass er außerordentlich sorgfältig alle an ihn gerichteten Rechtsvorschriften kennt und hierbei auch noch die wesentliche Rechtsprechung berücksichtigt. Es handelt sich ja beileibe nicht nur um das Lebensmittelrecht, das Gleiche gilt für das Arbeitsrecht, das Sozialversicherungsrecht, die steuerrechtlichen Vorschriften einschließlich des Abzugverfahrens bei der Lohnsteuer, das Recht der Berufsgenossenschaften, das Gesellschaftsrecht, das Straßenverkehrsrecht einschließlich der Fahrpersonalverordnung, die verschiedenen Statistikgesetze, das Umweltschutzrecht und zahlreiche andere Rechtsgebiete.
Bei allen steht der einzelne Unternehmer im Brennpunkt, er ist der „Rechtsunterworfene“ (welch imperiale Sprech- und Denkweise übrigens!), sieht sich seinerseits aber zahlreichen Fachbehörden gegenüber, die lediglich ein kleines Spektrum aus dieser Masse der Vorschriften bearbeiten und selbst hier alle Mühe haben, den Überblick zu behalten.
Ein Gesetzgeber, der seine Existenzberechtigung immer wieder damit beweisen will, wie emsig er neue Gesetze erlassen hat, und sich nicht der Entrümpelung und Straffung der Rechtsordnung rühmt, sollte — mit Verlaub! — vor seinen Wähler geführt werden.
Schon aufgrund seiner schieren Masse ist die Rechtsordnung heute objektiv mittelstandsfeindlich. Ein klarer Fall von „legislative overstretch“!
Kein Wunder: Wenn man sich vor Augen führt, wer heute wirklich in Kaminrunden und ähnlichen Zirkeln Ohr und Hand der Entscheider findet: Handwerker und Mittelständler sind es jedenfalls nicht. Alle reden vom Mittelstand und fehlen bei deren Parlamentarischen Abenden, doch wenn Schrempp einlädt, ist das Gedrängel groß. Das gilt für Brüssel noch mehr als für Berlin. Dies muss nicht als naturgegeben hingenommen werden: es stellt vielmehr die Frage nach einer effektiven Interessenvertretung für den Mittelstand.
Hinzu kommt, dass bewährte Rechtsprinzipien auf dem Altar des Verbraucherschutzes geopfert werden.
Oder wie soll es beurteilt werden, dass zur höheren Weihe des Verbraucherschutzes nach dem Fernabsatzrecht jedermann das Rechts hat, ohne Angabe von Gründen einen eingegangenen Vertrag zu kündigen und auf Kosten seines Vertragspartners die aufgerissene Packung zurückzusenden und den vollen Kaufpreis erstattet zu verlangen. Hier geht es ja nicht nur um OTTO oder QUELLE.
Lässt man mit diesen pflichtenlosen Rechten einem handwerklichen Unternehmer, der von morgens bis abends dafür arbeitet, in einem harten Wettbewerb sein Geschäft über die Runden zu bringen, tatsächlich Gerechtigkeit widerfahren? „Pacta sunt servanda“? — „Play it again, Sam!“ Wer braucht hier eigentlich die Sorge des Gesetzgebers?
Recht und Sprache
Recht materialisiert sich im Medium der Sprache. Als Leitfaden sollte die Empfehlung von Montesquieu stehen, der dem Gesetzgeber riet, wie ein Philosoph zu denken, aber wie ein Bauer zu reden. Schlechte Sprache ist immer schlechtes Recht, während der Umkehrschluss nicht ohne weiteres zulässig ist, da sich bekanntlich auch jeder Unsinn durchaus elegant formulieren lässt, denn sonst müssten wir große Teile geisteswissenschaftlicher Elaborate entbehren.
Das El Dorado schlechter Gesetzestechnik und verhunzter Rechtssprache ist das Lebensmittel- und Verbraucherschutzrecht.
Unkenntnis der realen Sachverhalte, Voreingenommenheit je nachdem, woher der politische Wind weht, ellenlange Schachtelsätze, doppelte Negationen, Inkonsistenz der Begriffe, falsche Prämissen sind nur einige Beispiele. Auch mit der Grammatik hapert’s.
Dazu einige Beispiele zur Eingewöhnung aus dem Verbraucherschutzrecht, die ich einem Beitrag in der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW) entnommen habe:
„Die verbleibenden Klauseln müssen jedoch weiterhin gelten und der Vertrag im Übrigen auf der Grundlage dieser Klauseln für beide Teile verbindlich sein.“
Der Vertrag muss verbindlich sein!
Oder:
„Nach Ablauf dieser Frist (bloß nicht: nach dieser Frist!) können Proben gemäß den Bestimmungen des Artikels 98 Absätze 2 und 3 der Verordnung EG Nr. 1623/2000 erhalten werden“.
Können Proben erhalten werden! Karl Kraus hätte diese „Sprache auf Stelzen“ mit dem Satz karikiert: „Sterbend brachte man sie ins Spital, wo sie einem toten Kind das Leben schenkte.“
Jetzt einige Beispiele für Fortgeschrittene aus dem § 1 Absatz 6 der Rückstands-Höchstmengenverordnung. Es handelt sich bei dem Folgenden um einen einzigen Satz:
„Lebensmittel, in oder auf denen Stoffe über die in Absatz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1 und 2, Absatz 4 oder nach Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang 1 Abschnitt 1 der Verordnung EG Nr. 466/2001 der Kommission vom 8. März 2001 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln (Amtsblatt EG Nr. L 77 Satz 1), zuletzt geändert durch die Verordnung EG Nr. 563/2002 der Kommission vom 2. April 2002 (Amtsblatt EG Nr. L 86 Seite 5, Nr. L 155 Seite 63, 2003 Nr. L 8 Seite 46), festgesetzten Höchstmengen hinaus oder höhere als nach Absatz 5 zulässige Mengen an Pflanzenschutzmittel vorhanden sind, dürfen gewerbsmäßig unbeschadet der Regelung in § 14 Absatz 1 der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes auch dann nicht in den Verkehr gebracht werden, wenn ihr Gehalt an diesen Stoffen ganz oder teilweise auf Verunreinigungen der Luft, des Wassers oder des Bodens zurückzuführen ist.“
Mit diesen Schachtelsätzen sollte man eine Kartonagenfabrik gründen!
Ein weiteres Beispiel aus dem Chemikaliengesetz:
„Die den Einführer betreffenden Vorschriften dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen zur Anmeldung neuer Stoffe finden entsprechende Anwendung auf natürliche oder juristische Personen oder nichtrechtsfähige Personenvereinigungen mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland, die einen neuen Stoff als solchen oder als Bestandteil einer Zubereitung aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft und nicht Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum ist, in einem anderen Mitgliedstaat oder Vertragsstaat verbringen, sofern es nicht lediglich um einen Transitverkehr nach § 3 Nr. 8 zweiter Halbsatz handelt.“
Diese schwelgerische Wortplattelei hätte man ohne Informationsverlust auch abkürzen können als: „Die den Einführer betreffenden Vorschriften gelten nicht für den Transitverkehr.“
Von falschen Prämissen und ihren Folgen
In der Begründung für Art. 1 Buchstabe a) der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) unterstellt die EU, dass die Vorschriften „zur Vermeidung einer weiteren Verschlechterung … des Zustandes der aquatischen Ökosysteme“ erforderlich seien. Schon die Prämisse ist falsch: Der Zustand der Gewässer („aquatische Ökosysteme“) ist in Wahrheit seit Jahren immer besser geworden! Wie kann man von solcher Voreingenommenheit zu vernünftigen Regeln gelangen? Der deutsche Gesetzgeber hat das dann in § 33a Absatz 3 Wasserhaushaltsgesetz in „Trendumkehr“ übersetzt, was auch nicht besser ist. Ähnliche „selbstbegründende“ Begründungen finden sich in zahllosen „Verbraucherschutzgesetzen“.
Schluss
Gutes Recht soll klar, verständlich und überschaubar für denjenigen sein, an den es sich wendet. Hier können wir viel von der Schweiz lernen. Weniger ist oft mehr. Begriffe müssen im jeweiligen Zusammenhang einheitlich verwendet werden. Doppelte Negationen sind des Teufels! Aktiver Stil ist verständlicher als gestelzte Passivkonstruktionen. Begründungen („Erwägungsgründe“) sollten vernünftig strukturiert, realistisch und nicht nur geschwätzig sein.
Nicht zuletzt: Rechtssätze müssen hierarchisch klar gegliedert werden, um sinnverwirrende Gesetzeskonkurrenzen zu vermeiden. Und: Recht muss sich von einem Vorverständnis ableiten, dass ein der Freiheit verpflichtetes Menschenbild von erwachsenen, mündigen Menschen zugrunde legt. In diesem Sinne birgt der gesetzesleitende Topos des schutzbedürftigen „Verbrauchers“ erhebliche Freiheitsrisiken.
Stattdessen beobachten wir bedenkliche Entwicklungslinien im Verbraucher- und Lebensmittelrecht, die sich wie gezeigt zu folgenden Schlagworten verdichten lassen:
- Vom Sach- zum Anspruchsrecht
- Vom Individualrecht zum Kollektivrecht
- Vom wechselseitigen Vertrag zum pflichtenlosen Anspruch
- Von der Produkt- zur Ernährungsverantwortung
- Vom Bürgerrecht zum Betreuungsrecht
- Vom Ermöglichungsrecht zum Verhinderungsrecht
Statt des Monsters „Betreuungsstaat“ mit seinen Kollektivierungstendenzen, der Inflation schlechter Regeln und dem allumfassenden Vorsorgewahn brauchen wir in „old Europe“ dringend einen Geist der Gesetze, der Neugier, Pioniergeist, Tatendrang und Lust auf Neues entfaltet: Nicht der status quo sollte gesetzlich privilegiert sein, sondern wann immer vertretbar der status ad quem. Statt Beharrung sollte Fortschritt ermutigt werden. Denn noch immer - so weit wir auch zurückblicken - war die Zukunft allemal verheißungsvoller als die Vergangenheit!
Das wäre eine wahrhaft zeitgemäße Form des Montesquieu’schen „Geistes der Gesetzgebung“.